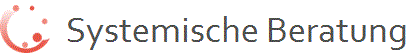Überrollende Gefühle wie Wut, Trauer, Angst, die keinen Bezug zur eigenen Lebenssituation haben, oder auch Panikattacken sowie wiederkehrende (Alp-)Träume, die sich nicht aus der Biographie erklären lassen, können die Frage aufwerfen, ob man weniger an einem eigenen Trauma leidet als an einem Trauma, das die Eltern oder Großeltern erlitten haben.
Überrollende Gefühle wie Wut, Trauer, Angst, die keinen Bezug zur eigenen Lebenssituation haben, oder auch Panikattacken sowie wiederkehrende (Alp-)Träume, die sich nicht aus der Biographie erklären lassen, können die Frage aufwerfen, ob man weniger an einem eigenen Trauma leidet als an einem Trauma, das die Eltern oder Großeltern erlitten haben.
Die Psychotherapeutin und Trauma-Expertin Katharina Drexler hat aus eigenem biographischem Hintergrund heraus die Thematik der „ererbten Wunden“ erkannt und ein Therapieverfahren dafür entwickelt. In ihrem Buch „Ererbte Wunden erkennen“ führt sie in für Laien und Betroffene sehr verständlichen Schritten und Erklärungen in das Thema der ererbten Wunden ein und gibt mit Übungen Anleitung, um Belastungen zu mindern.
Um ein traumabedingtes Verhalten der Vorfahren besser verstehen und einordnen zu können, gibt die Autorin vorab eine Einführung zu traumatischen Erlebnissen und möglichen Folgen. Dabei macht sie deutlich, dass nicht jedes traumatische Erlebnis zwangsläufig auch ein Trauma zur Folge hat, denn „die Ressourcenlage eines Menschen spielt eine große Rolle bei der Bewältigung eines potenziell traumatischen Ereignisses“ (S. 21).
Man könnte es so formulieren, „dass ein potenziell traumatisches Ereignis zu einer Traumatisierung (Verletzung) führen kann, durch die man dann gegebenenfalls ein Trauma (eine Wunde) davontragen kann, aus dem sich wiederum einen Traumafolgestörung entwickeln kann“ (S. 21). Eine Trauma-Therapie hat dann unterschiedliche Facetten: die Stabilisierungsphase, Vermittlung von Wissen über die Folgen von Traumata, eine Trauma-Aufarbeitung und die Integrationsphase: „In der Integrationsphase wird das bis dahin abgespaltene traumatische Ereignis zu einem Teil der Lebensgeschichte und so in den zeitlichen Ablauf der eigenen Biographie eingebettet“ (S.34).
Bei der transgenerationalen Traumatisierung spricht die Autorin dann „ganz bewusst von ererbten und nicht von vererbten Wunden. Denn der Ausdruck ‚Vererben‘ verweist auf diejenigen, die etwas hinterlassen haben. Der Ausdruck ‚Ererben‘ hingegen rückt die Generationen ins Zentrum, die etwas übernommen haben. Meist versuchen die Vorfahren alles, um ihre Nachfahren vor den erlittenen traumatischen Erlebnissen zu schützen. Ihnen liegt also nichts ferner, als etwas von ihren Wunden vererben zu wollen. Dennoch spürt das Kind eine unausgesprochene Last und versucht, es den Eltern leicht zu machen“ (S. 37).
Bei der Weitergabe von Traumata spielt die Interaktion zwischen (Groß-)Eltern und den Nachkommen einen wichtige Rolle ebenso wie deren Einfühlungsvermögen. Auch das Konzept der inneren Anteile (Introjekte – vom kindlichen Erleben geprägte innere Abbilder wichtiger Bezugspersonen), die neurobiologische Komponente der Spiegelneuronen und die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik werden im Buch für interessierte Laien verständlich ausgeführt.
In neun Fallgeschichten aus ihrer Praxis werden die theoretischen Grundlagen mit Beispielen angereichert und die therapeutische Methode von Katharina Drexler zur Aufarbeitung und Integration der ererbten Wunden vorgestellt. Dabei wird am Ende nochmal für den Unterschied von eigenen und ererbten Wunden sensibilisiert.
Abgerundet wird das Buch mit Imaginationen und Übungen für Betroffene, die beim Verlag auch als Hördateien, von der Autorin selbst eingesprochen, heruntergeladen werden können.
Fazit: Sowohl für Betroffene, die sich fragen ob ihre Symptome zu ihnen oder zu einem Trauma in der Vorgängergeneration gehören, als auch für Professionelle, die einen ersten Einblick in die Thematik der Ererbten Wunden bekommen wollen, ein sehr empfehlenswertes Buch.